"Jahrbuch Ganztagsschule 2006": Schwerpunkt Schulkooperationen : Datum: Autor: Autor/in: Ralf Augsburg
Das neue "Jahrbuch Ganztagsschule 2006" legt seinen Schwerpunkt auf das Thema Schulkooperationen. Doch neben diesem Leitthema widmet sich der Band in bewährter Weise auch vielen anderen Themen - von Länderberichten über Praxisbeispiele aus Schulen bis hin zu Nachrichten und Stellungnahmen diverser Verbände.
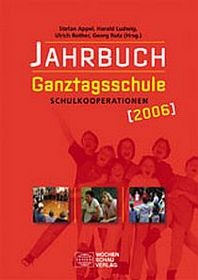
Das "Jahrbuch Ganztagsschule 2006" trägt im Untertitel das Wort "Schulkooperationen". Nach den mit "Neue Chance für die Bildung" und "Investition für die Zukunft" eher allgemein gehaltenen Untertiteln der beiden Vorjahre ist von den Herausgebern diesmal also ein speziellerer Schwerpunkt gewählt worden. Stefan Appel, der Vorsitzende des Ganztagsschulverbandes, Prof. Dr. Harald Ludwig von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, Ulrich Rother, stellvertretender Vorsitzender des Ganztagsschulverbandes und Georg Rutz, Ministerialrat im Ruhestand, begründen dies in ihrem Vorwort damit, dass
"die gegenwärtige Ganztagsschulentwicklung die Schulkooperationen nicht nur im größeren Maße einbezieht, als das in früheren Jahrzehnten der Fall war, sondern dass Schulkooperationen aus unterschiedlichen Gründen unerwartete Wertschätzung erfahren. Bildungspolitiker, Finanzexperten, Wissenschaftler und pädagogische Praktiker scheinen sich darin einig, dass die Realisierung ganztägiger Schulkonzeptionen ohne außerschulische Partner nicht mehr stattfinden kann oder soll - aber in welchem Ausmaß, mit welchem Auftrag und in welcher Verzahnung die Mitarbeit eingebracht werden soll, das wird durchaus unterschiedlich gesehen."
In der Tat setzen einige Bundesländer beim Ausbau gerade offener Ganztagsschulen, so beispielsweise Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, auf die Einbindung außerschulischer Partner. Für die Herausgeber ist das sinnvoll: "Kooperationspartner regen an, andere Lernarrangements zu nutzen und das Lernen am anderen Ort zu ermöglichen. Die Mitarbeit außerschulischer Fachkräfte der Kooperationspartner kann dazu beitragen, die Schule zu öffnen, sie stärker kommunalpolitisch zu verankern und als Bestandteil einer sozialen und pädagogischen Infrastruktur zu entwickeln."
In drei Beiträgen widmen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dem Thema Kooperation aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Diplompädagogin Dr. Maria Icking und Dr. Ulrich Deinet vom Landesjugendamt Westfalen-Lippe untersuchen die "Schule in Kooperation - mit der Jugendhilfe und mit weiteren Partnern im Sozialraum". Ihre These ist, dass in der Kooperation von Schule und Jugendhilfe große Chancen liegen, wenn diese nicht allein als Notlösung wegen knapper Ressourcen betrachtet wird, sondern sich beide Systeme auf einen erweiterten Bildungsbegriff verständigen, der den Wert informeller Bildung anerkennt.
Externe Partner sind ein Schatz für Schülerinnen und Schüler
Durch eine schriftliche Befragung von 424 Kommunen und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen ermittelte das Autorenpaar, welche institutionellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Kooperation man dort jeweils geschaffen hatte. Ein Ergebnis: In über 80 Prozent der Kommunen werden Kooperationsprojekte zwischen Jugendhilfe und Schule durchgeführt. In fast 80 Prozent der Kommunen mit Jugendamt und knapp 40 Prozent der Kommunen ohne Jugendamt wurden bereits Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen, überwiegend Vereinbarungen zur Offenen Ganztagsgrundschule. Allerdings schreiben Icking und Deinet auch: "In welchem Umfang in den Kooperationsverträgen eine neue Qualität von Bildungsprozessen im Sinne informeller Bildung realisiert wird, ist so noch nicht erkennbar."
Dr. Karlheinz Thimm, Professor für Kinder- und Jugendhilfe an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin betrachtet die "Ganztagspädagogik in der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe" und wägt dabei die Befürchtungen und Chancen durch den Ganztag aus Sicht der Jugendhilfe ab. Thimm kommt zu dem Ergebnis, dass die "Anreicherung durch mehrere Professionen und Erfahrungskulturen von Externen ein Schatz für die Schülerinnen und Schüler" ist: "Lebenswelt-, Kultur-, Bewegungs- und Gesundheitsexpertise von Dritten ist eine Säule einer neuen Schule." Die Jugendhilfe könne ihre Kompetenzen besonders bei der individuellen Förderung, beim Arrangement von anregenden Milieus und von bildenden Gelegenheitsstrukturen, bei Selbstbildung, in der Partizipation von Kindern und Jugendlichen, der Aktivierung von Eltern und der Öffnung zum Gemeinwesen einbringen.
Entsteht eine "Neue Lernkultur durch Kooperation von Ganztagsschulen mit außerschulischen Akteuren"? Diese Frage versucht Dr. Jens Lipski vom Deutschen Jugendinstitut in München zu beantworten. Der Diplom-Soziologe legt seinem Artikel die Studie "Schule und soziale Netzwerke" des Deutschen Jugendinstituts zu Grunde, einer bundesweiten Befragung zur Zusammenarbeit allgemein bildender Schulen mit außerschulischen Kooperationspartnern. Lipski kommt dabei zu einem skeptischen Befund: "Die konzeptionelle Einheit von Unterricht und außerunterrichtlichen Aktivitäten wird vermutlich nur hinsichtlich der Angebote in Form einer unterrichtsbezogenen individuellen Förderung realisierbar sein." Allerdings finde an manchen Schulen auch eine enge und produktive Zusammenarbeit statt, und zwar dann, wenn die Schulen bereits selbst projektartige Arbeitsformen entwickelt hätten.
Kosten als Investitionen in die Zukunft begreifen
Das Deutsche Jugendinstitut ist auch an einem der beiden Länderberichte im "Jahrbuch Ganztagsschule 2006" beteiligt. In einem Kooperationsverbund mit vier wissenschaftlichen Instituten in Nordrhein-Westfalen hat das DJI eine Untersuchung über erste Erfahrungen und Bewertungen der beteiligten Akteure an der "Offenen Ganztagsschule im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen" vorgenommen. Die Ergebnisse wurden im Januar 2005 auf der Tagung "Ein Jahr Offene Ganztagsschule in NRW" vorgetragen und sind im Jahrbuch noch einmal abgedruckt.
Aus Hessen berichtet der Landesvorsitzende des Ganztagsschulverbandes Guido Seelmann-Eggebert unter der Überschrift "Ganztagsschulen in Hessen zwischen Anspruch und Wirklichkeit". Der Diplom-Pädagoge setzt sich kritisch mit dem "Ganztagsprogramm nach Maß" der Landesregierung auseinander und konstatiert eine "dürftige Entwicklung". Die Ganztagsschulzahl sei zwar "geradezu explosionsartig" gewachsen, doch qualitativ komme die so genannte "Pädagogische Mittagsbetreuung" mit ihrem "minimalen personellen Einsatz" den bildungspolitischen Notwendigkeiten nicht nach.
Seelmann-Eggebert ist ein weiteres Mal als Autor im "Jahrbuch 2006" vertreten und stellt im "Praxis"-Kapitel das Versorgungskonzept seiner Schule, der Integrierten Gesamtschule Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden, vor. Die Caritas Wiesbaden ist hier seit 1996 der Versorger, was laut Seelmann-Eggebert "ein Glücksfall" ist. Die frisch zubereiteten Speisen, Obst und Gemüse aus biologischem Anbau und das Fleisch vom ortsansässigen Metzger kommen gut bei den Kindern und Jugendlichen an. Der Stufenleiter der Klassen 7 - 10 weist auch auf die Folgen dieses Ernährungsverhaltens und des gemeinsamen Essens für Gesundheit und Sozialverhalten in der Zukunft hin: "Die Kosten für die Einrichtung von Ganztagsschulen müssen immer auch unter dem Aspekt der Einsparung von künftigen Kosten sowohl im Sozial- wie auch im Gesundheitsbereich gesehen werden." Darüber hinaus sorge die Akzeptanz der Mahlzeiten für den Abbau von Aggressionen, und das Wohlfühlklima in der Mensa stecke auch das Kollegium an. Die Schülerinnen und Schüler fielen bei Klassenfahrten durch höfliches und professionelles Verhalten beim Essen auf.
Sinnorientierung und Scheidungskinder
Einem ganz anderen, unerwarteten Thema widmet sich Dr. Friedrich Schweitzer - dem Zusammenhang zwischen "Ganztagsbildung und Religion: Werteerziehung, Sinnorientierung, interreligiöses Lernen". Der Professor für Religionspädagogik an der Universität Tübingen nennt Möglichkeiten für Angebote religiöser Erziehung, Begleitung und Bildung, die antirassistische Projekte, Projekte zum Fairen Handel und globaler Gerechtigkeit, auch Integrationsprojekte und internationale Schulpartnerschaften umfassen können. "Wo Religion auf diese Weise pädagogisch reflektiert und kompetent in Ganztagsangebote einbezogen wird, können die prinzipiellen Vorbehalte gegen eine entsprechende Öffnung von Schule für Religion kaum mehr überzeugen", behauptet der Wissenschaftler. "Ohne Religion würde nicht nur die Ganztagsschule wichtige Gestaltungsmöglichkeiten verlieren, sondern vor allem würde den Kindern und Jugendlichen die Chance zu einer Auseinandersetzung mit Grundfragen und -erfahrungen des Lebens und Glaubens genommen."
Interessant ist auch Elisabeth Schlemmers Auseinandersetzung mit dem Thema "Schwierige Familienbiographien von Kindern - ein Fall für die Ganztagsschule?" Die aktuelle Diskussion um die Ganztagsschule sei von der Diskussion um den Wandel von Familie, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Erhöhung der Chancen von Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft und Familienmilieus nicht zu trennen. Die Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Weingarten bezieht bei ihren Folgerungen die Ergebnisse ihrer Längsschnittstudie "Familienänderung und Schulerfolg" ein und entwickelt daraus "Handlungsperspektiven in Ganztagsschulen". Sie folgert: "Bei Scheidungskindern sind die Kontinuität in der Betreuung und die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz entscheidende Förderfaktoren, die in Ganztagsschulen aufgrund des freizügigeren zeitlichen Rahmens sinnvoll gestaltet werden können."
Die Praxisbeispiele im "Jahrbuch 2006" stammen diesmal neben der erwähnten IGS Hermann Ehlers-Schule Wiesbaden aus Berlin (Grundschule Köllnische Heide) und Bayern (Realschule Jacob-Ellrod-Schule Gefrees). Hier stellen Schulleiterin Astrid-Sabine Busse beziehungsweise Schulleiter Peter Hottaß die pädagogischen und organisatorischen Konzepte ihrer Schulen vor. Stefan Appel steuert einen Beitrag zum "Lernatelier - eine Lernlandschaft in der Ganztagsschule" an seiner Ganztagsschule Hegelsberg in Kassel bei.
Den Band runden Berichte über den Ganztagsschulkongress 2004 in Berlin, den Bundeskongress des Ganztagsschulverbandes 2004 in Essen und den 12. Jugendhilfetag 2004 in Osnabrück sowie Stellungnahmen und Empfehlungen des Grundschulverbands, der Evangelischen Kirche Deutschland, des Arbeitskreises Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher, des Verbandes der Waldorfschulen und des Bundesjugendkuratoriums ab.
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

