Wie sehen Schulleitungen die Ganztagsschule? : Datum: Autor: Autor/in: Ralf Augsburg
Die ersten Ergebnisse der "Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen" für die Phase 2012 bis 2015 liegen vor. Projektkoordinatorin Dr. Jasmin Decristan im Interview.
Kürzlich veröffentlichte das Konsortium der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen – StEG“ den Bericht „Ganztagsschule 2014/15 – Deskriptive Befunde einer bundesweiten Befragung“.

Er basiert auf einer 2015 durchgeführten repräsentativen Online-Befragung von mehr als 1.500 Schulleitungen von Ganztagsschulen. Der Bericht bietet zunächst eine aktuelle Bestandsaufnahme des Ausbaus, liefert aber zugleich Trendanalysen im Vergleich mit einer ersten Befragung dieser Art im Jahr 2012. Bei den Schulleitungsbefragungen stehen vier Themenkomplexe im Fokus: 1. Organisation und Strukturen, 2. Schulische Ressourcen, 3. Pädagogische Konzepte und Schulentwicklung sowie 4. Angebote und Teilnahme. Neu bei der aktuellen Befragung: Ein Fragenblock hat sich mit dem Thema „Inklusion“ aus Perspektive von Ganztagsschulen befasst.
Online-Redaktion: Frau Dr. Decristan, was ist die Aufgabe einer Projektkoordinatorin?
Jasmin Decristan: Der StEG-Forschungsverbund ist aus vier Standorten zusammengesetzt: dem Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt am Main, dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München, dem Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Technischen Universität Dortmund und der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Zusätzlich wird StEG unterstützt durch zwei Beiräte, einen administrativen und einen wissenschaftlichen Beirat. Meine Aufgabe ist es, zunächst einmal den Überblick über die verschiedenen Aktivitäten des Forschungsverbundes an diesen Standorten zu sichern. Ich begleite die Prozesse, die innerhalb des Konsortiums abgestimmt werden, und halte den Kontakt zu den Beiräten, zum BMBF und zum Projektträger. Es geht also um die Koordination der Kommunikation und der Abläufe.
Online-Redaktion: Das hört sich nach vielen Telefonaten und E-Mails an...

Decristan: Es ist sicherlich eine herausfordernde Tätigkeit, weil wir ja beispielsweise im Rahmen der Schulleitungsbefragung auch mit allen 16 Bundesländern zusammenarbeiten. Da ist eine Menge an Abstimmung notwendig. Aber wir haben auch ein großes und gutes Team, das die Arbeit voranbringt.
Online-Redaktion: Welchen Platz hat die Schulleitungsbefragung „Ganztagsschule 2014/15“.im Gesamtkonstrukt der StEG-Studie?
Decristan: Es gibt einerseits die Schulleitungsbefragung und andererseits die vier Teilstudien an den Forschungsstandorten. Die Schulleitungsbefragung ist eine gemeinsame Aufgabe des Forschungsverbundes, hier arbeiten alle vier Institutionen mit verschiedenen Aufgabenbereichen an der gemeinsamen Zielsetzung. Die Befragung hilft uns auch bei den Teilstudien in zweierlei Hinsicht: Zum Einen haben wir aus dem Pool der Schulleitungsbefragung einen wesentlichen Teil der Schulen für die Teilstudien gewonnen, zum Anderen können wir die Ergebnisse der Teilstudien vor dem Hintergrund der Schulleitungsbefragung besser einordnen.
Online-Redaktion: Wie haben Sie die Befragung durchgeführt?
Decristan: Wir haben auf Basis aller Schulen, die in den Kultusministerien der Bundesländer als Ganztagsschulen geführt werden, eine repräsentative Stichprobe ausgewählt und diese dann angeschrieben. In dem Anschreiben erhielten die Schulleitungen den Zugang zu unserem Online-Fragebogen. Wir haben uns für die schnelle und kostengünstige Online-Befragung entschieden, denn Sie können sich vorstellen, dass wenn man solch eine Befragung bei 1.500 Schulleitungen papierbasiert durchführt, es schnell recht teuer und bei der Auswertung auch sehr zeitaufwendig werden kann. Es scheint auch für die Schulleitungen ein akzeptiertes Medium gewesen zu sein.

Online-Befragung: Können Sie die Ergebnisse von 2015 auch mit den ersten StEG-Erhebungen von 2005 bis 2009 vergleichen, bei denen ebenfalls Schulleitungen befragt worden waren?
Decristan: Das ist nur in Teilen möglich. Erstens sind die befragten Schulen nicht komplett dieselben, und zweitens wurden die Fragen in den Erhebungen von 2012 und 2015 weiter angepasst. Auch bei den beiden letzten Erhebungen sind die befragten Schulleitungen nicht dieselben. Es handelt sich hier nämlich nicht um einen Längsschnitt, sondern um einen sogenannten Trendvergleich. Wir erhalten so einmal eine repräsentative Abbildung der Ganztagsschullandschaft 2012 und einmal der von 2015. Die Entwicklung wird dabei im Trend sichtbar. Im Fazit des Berichts zur StEG-Schulleitungsfragung versuchen wir aber die Ganztagsschulentwicklung seit Einführung des IZBB-Programms in den Blick zu nehmen und da helfen uns natürlich auch die vorherigen Befragungen.
Online-Befragung: Welche Ihrer Ansicht nach interessanten Entwicklungen zeichnen sich aus Perspektive der Schulleitungen ab?
Decristan: Ein wesentliches Kriterium der Kultusministerkonferenz für eine Ganztagsschule ist die Verknüpfung von Unterricht und Ganztagsangeboten. In der Befragung sehen wir, dass etwa die Hälfte aller Schulleitungen angibt, dass Unterricht und außerunterrichtliche Angebote in ihrer Schule noch recht wenig verbunden sind.

Das gilt für die Primar- und für die Sekundarschulen gleichermaßen. An den Primarschulen ist sogar eine leichte Zunahme dieser Trennung festzustellen. Führt man sich die Absicht der Verknüpfung vor Augen – die Vertiefung von Unterrichtsinhalten oder die Betrachtung eines Lernthemas aus einem anderen Blickwinkel – und sieht diese als eine wesentliche pädagogische Chance von Ganztagsschulen, dann ist das nicht optimal. Hier besteht noch Handlungsbedarf.
Online-Befragung: Ein bisheriges Ergebnis der StEG-Studie war, dass die regelmäßige Teilnahme an qualitativ anspruchsvoll gestalteten Angeboten einen Effekt haben kann. Was sagen die Ergebnisse über die aktuelle Teilnahmefrequenz aus?
Decristan: Die freiwillige Teilnahme ist weiterhin das vorherrschende Modell, besonders in der Grundschule, wo rund 80 Prozent der Ganztagsschulen mit offenen Angeboten arbeiten. Insgesamt nimmt laut Schulleitungen etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler am Ganztag teil. Was die Öffnungszeiten der Ganztagsschulen betrifft, nennt die KMK als Mindestkriterium, dass Ganztagsangebote an drei Wochentage vorhanden sind. Die meisten Ganztagsschulen übertreffen dies mit vier Tagen, aber zugleich ist der Anteil der Schulen, die nur an zwei Tagen einen verlängerten Schultag anbieten, auf etwa 10 Prozent gestiegen. Wenn man an weniger als drei Tagen ein Ganztagsangebot bereitstellt, ist es aus unserer Sicht schon fraglich, ob es sich hier um eine Ganztagsschule handelt.
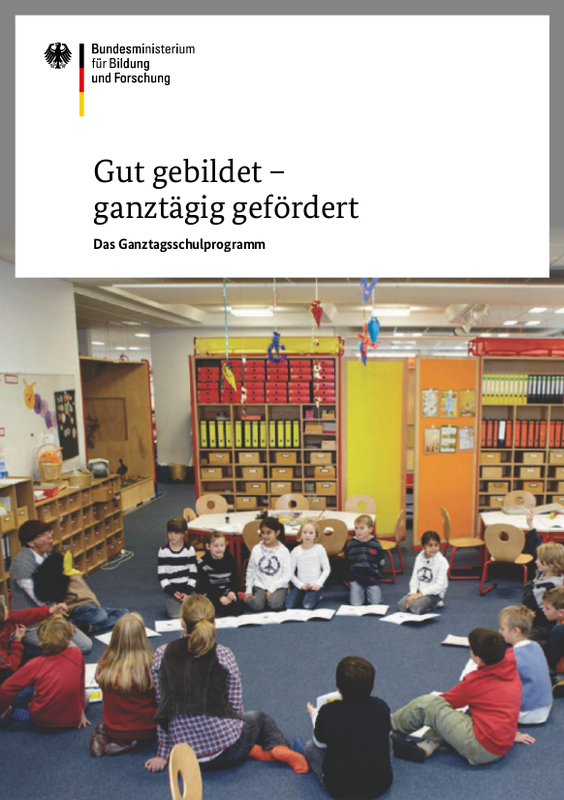
Online-Befragung: In der Pressemitteilung hat das Konsortium das Fehlen eines einheitlichen pädagogischen Konzepts der Ganztagsschulen in Deutschland als „Beliebigkeit“ kritisiert. Umgekehrt könnte man doch aber sagen, dass es ein Zeichen für pädagogische Vielfalt und vielleicht sogar wünschenswert ist, wenn in einem so großen, föderal organisierten Land Schulen unterschiedliche Ansätze wählen?
Decristan: Ich würde das aus zweierlei Perspektive betrachten. Ich stimme Ihnen zu, dass die Vielfalt zeigt, was die Schulen alles aus der Ganztagsschule machen können. Ein reichhaltiges Bildungsangebot mit verschiedenen Kooperationspartnern in unterschiedlichen regionalen Bildungslandschaften hat das Potenzial, die verschiedenen Bedarfe abzudecken.
Ich denke aber, dass man sich grundsätzlich darauf verständigen sollte, was überhaupt als eine Ganztagsschule anzusehen ist. Insbesondere aus Sicht der Eltern scheint mir das wichtig, denn Eltern müssen wissen, was sie erwarten können, wenn sie ihre Kinder an einer Ganztagsschule anmelden. Momentan beobachten wir, dass das, was eine Ganztagsschule ausmacht, in den Bundesländern zunehmend unterschiedlich definiert wird. Da droht aus unserer Sicht insofern wirklich eine gewisse Beliebigkeit, da würden wir uns mehr gemeinsame Nenner wünschen.
Online-Befragung: In aktuellen Befragung ist auch das Thema Inklusion aufgenommen worden. Wie stellen Sie da den Bezug zum Ganztag her?
Decristan: Das Thema ist derzeit sehr präsent in Bildungspolitik und Bildungsforschung, und wir wollten die Chance ergreifen, auch aus Sicht der Ganztagsschulforschung etwas dazu beizutragen. Der Begriff „Inklusion“ ist dabei ein durchaus streitbarer Begriff, viele verstehen etwas Anderes darunter. Um einen Zugang zu bekommen, haben wir uns auf eine gängige Variante fokussiert und die Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Ganztagsschulen in den Blick genommen.

Wir haben die Schulleiterinnen und Schulleiter zuerst gefragt, ob an ihren Schulen überhaupt Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen. Das ist an rund 90 Prozent der Ganztagsschulen im Primar- und Sekundarstufenbereich der Fall, an Gymnasien sind es nur 50 Prozent, was kein wirklich neuer Befund ist. Was wir aber sagen können, ist, dass die meisten Schulleitungen der Primar- und Sekundarschulen erklärt haben, der Ganztagsbetrieb berge ein besonderes Potenzial für die Inklusion, die Organisationsform und die Pädagogik seien hierfür besonders förderlich. Lediglich ein Drittel der befragten Schulleiter von Gymnasien meint, dass Ganztag und Inklusion nichts miteinander zu tun hätten.
Kategorien: Forschung - Ganztagsschulforschung: Interviews
Die Übernahme von Artikeln und Interviews - auch auszugsweise und/oder bei Nennung der Quelle - ist nur nach Zustimmung der Online-Redaktion erlaubt. Wir bitten um folgende Zitierweise: Autor/in: Artikelüberschrift. Datum. In: https://www.ganztagsschulen.org/xxx. Datum des Zugriffs: 00.00.0000

